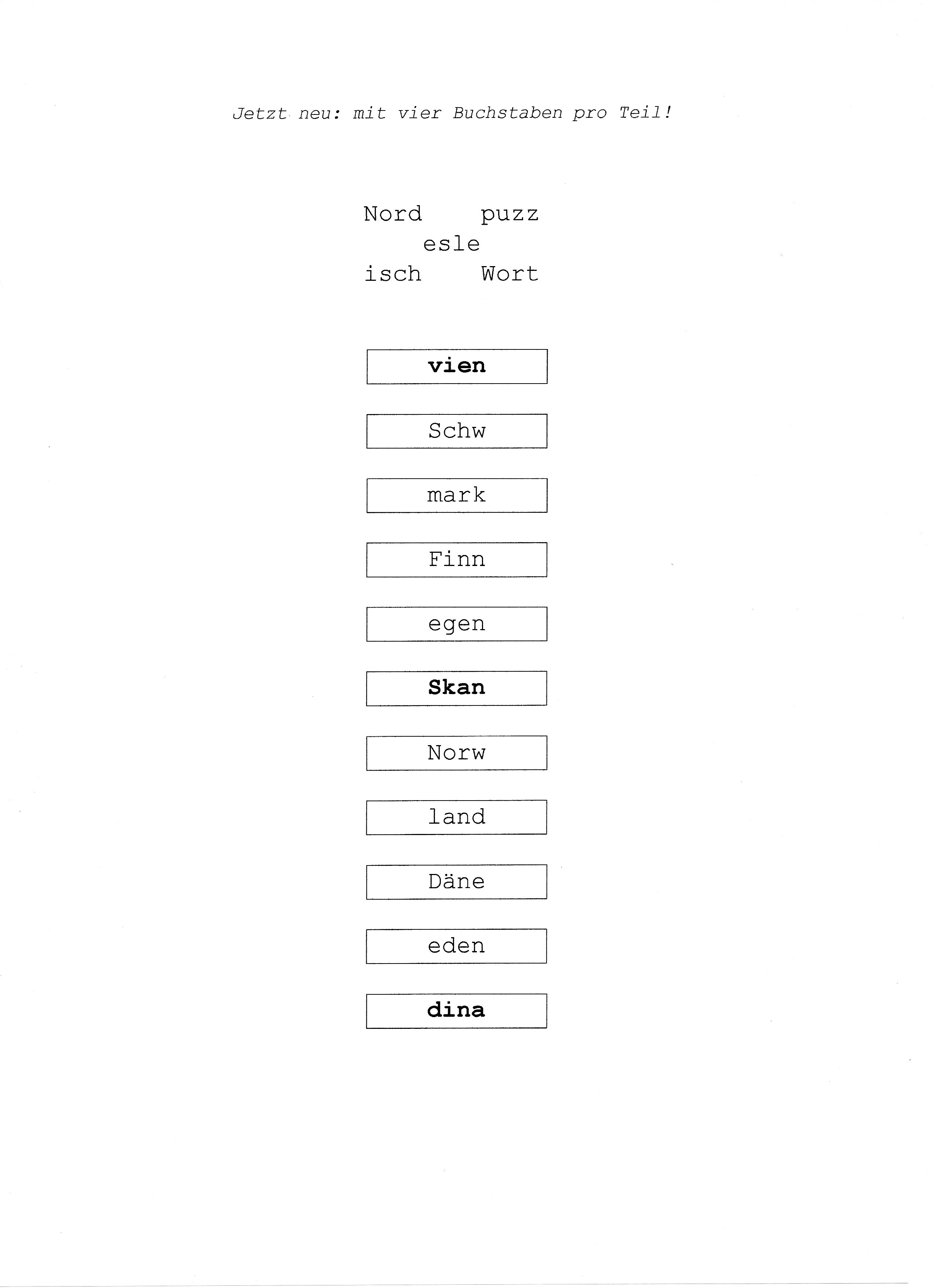Archiv der Kategorie: Wisuelles
Wo alle Worte zuwenig wären, da hilft vielleicht Wisuelles.
Sonniger Septembertag
Ich sehe Bilder, auf dem Bildschirm. Ich sehe sie jetzt, fünfzehn Jahre später. Sie faszinieren noch immer. Was ist jetzt anders an diesen Bildern als vor fünfzehn Jahren? Glaube ich, jetzt etwas zu wissen über diese Bilder, obwohl ich gar nichts über sie weiß? Ist die Geschichte dieser Bilder jetzt erzählt? Kann man die Bilder jetzt deuten und bewerten? Es sind Bilder, Bilder, Bilder, aufgenommen von Kameras, die mehr oder weniger nahe am Ort des Geschehens waren, vor fünfzehn Jahren.
Ich versuche mir vorzustellen: Die Bilder im Kopf der Menschen im brennenden Gebäude. Die Visionen der hilflosen Menschen in den Stockwerken über den Einschlägen der Flugzeuge. Die Geschichten dieser Menschen, die sie uns nie erzählen werden, weil sie alle gestorben sind. Die Bilder im Kopf der Selbstmordattentäter, als sie mit einer Entschlossenheit in die Zerstörung rasen, mit riesigen Flugzeugen, nicht nur den Tod anderer, sondern ihren eigenen auf schrecklich plakative Weise willentlich in Kauf nehmend.
Ich sehe die ersten Fernsehbilder, nicht die späteren, die sich an Interpretationen und Deutungen versuchen. Ich sehe die ersten live gesendeten Fernsehbilder dieses sonnigen Morgens in New York am 11. September 2001, diese jungfräulichen, unschuldigen, nichtsahnenden Bilder, in deren Verlauf sich die beiden riesigen Zwillingstürme in Schutt und Asche auflösen. Ich höre das Ringen der Kommentatoren um Auflösung der Bilder, die nicht gelingt, weil ein Bild, sobald es gedanklich bearbeitet wird, vom nächsten abgelöst wird. War es ein Flugzeug-Unfall? Mitten in diese Überlegungen kracht das zweite Objekt in den anderen Turm. War es wieder ein Flugzeug? Wenn ja, was für ein Flugzeug? Das kann kein Unfall sein! wird nach dem zweiten Einschlag klar. Wer macht so etwas? Wie geht es den Menschen in den brennenden Türmen? Da stürzt einer der Türme inmitten einer riesigen Aschewolke in sich zusammen. Suche nach Augenzeugen im Chaos. Wer hat die Wahrheit im Blick? Gibt es denn Wahrheit, wenn jeder sie anders erlebt? Was ist die Wahrheit des Mohammed Atta, des ersten Todespiloten, an die er bis zur letzten Konsequenz geglaubt hat, mit der er den Tod über das Leben gestellt hat. Der Tod in Lower Manhattan, herbeigeführt mit menschlicher Energie, die fassungslos macht. Das Leben am Abgrund der Menschheit, die sich selbst vernichtet. Die Sonne scheint noch immer über New York an diesem Septembermorgen, aber nicht für die, die sich im Qualm und Staub von Lower Manhattan befinden.
Kann irgendjemand die Geschichte von 9/11 erzählen? Oder sind es nur die Bilder, die bleiben? Kann die Menschheit das reflektieren und deuten, oder ist sie überfordert damit? Die Welt in Gut und Böse zu teilen war das erste Lösungsmittel, das schon wenige Stunden nach der Katastrophe griff. Ist das die einzige Möglichkeit, diese Bilder zu verarbeiten? Warum sehe ich mir die Bilder an, nach fünfzehn Jahren? Ist das ein Sehnen nach Miterleben mit denjenigen, die dabei waren? Geräusche und Gerüche zu erfühlen und nicht nur Bilder zu sehen, die auf fatale Weise hängenbleiben – sondern Erleben, Durchleben?
Meine persönliche Geschichte ist die eines Liedes: Ich war noch niemals in New York. Mein Kopf ist voller Geschichten, die miteinander konkurrieren. Manchmal glaube ich, mein Kopf ist die ganze Welt. Doch das überfordert meinen Kopf. Ich will meine Gedanken verkleinern und nicht die ganze Welt einbeziehen. Ich will auch nicht die Geschehnisse in Lower Manhattan am 11. September 2001 in meinen Kopf einbeziehen, denn was gibt es an den Bildern zu deuten? In Wahrheit ist es so: Mein Kopf ist bereits überfordert, wenn er sich eine Geschichte ausdenkt und mein Bauch sie nicht gut findet. Mein Bauch bekommt heftige Übelkeit, wenn er eine Geschichte nicht gut findet, die mein Kopf erfunden hat, woraufhin mein Kopf sich dann gerne zurückzieht in sein gekränktes Gehirnstübchen. Ich habe mir also angewöhnt, Geschichten aus dem Bauch zu erzählen, was meinen Kopf dann neugierig macht und ihn aus seinem gekränkten Gehirnstübchen hervorlockt. Mein Kopf sagt: 9/11 – ich will das nicht sehen, ich will das nicht denken. Mein Bauch sagt: 9/11 – ich fühle es irgendwie, die Energie dieses Tages; ich will es erleben, ich will es durchleben. Ist mein Bauch also die ganze Welt und nicht mein Kopf?
Jedenfalls gebe ich dem Gefühl meines Bauches nach und erzähle etwas über 9/11: Es war der Beginn eines sonnigen Septembertages in Lower Manhattan… Ist dann so eine Geschichte entstanden, sind sie zufrieden, mein Bauch und mein Kopf. Aber kaum ist ein Tag vergangen, kommt mein Bauch wieder aus seiner stillen Zufriedenheit und stellt Fragen wie: Was ist das, die Welt? Was bedeutet das alles? Dann erzählt er wieder eine Geschichte, über die Welt und ihre Bedeutung. Denn wir wissen ja: Mein Bauch ist die ganze Welt.
Manchmal bin ich so mutig, die Geschichten, die mein Bauch gedichtet und mein Kopf genehmigt hat, jemandem anderen als mir zu erzählen. Je nachdem, wie sie dann drauf sind, mein Bauch und mein Kopf, während ich die Geschichte erzähle, entsteht jedesmal eine neue Geschichte, denn eine Geschichte von gestern ist heute schon eine andere Geschichte. Was mir beweist, dass nicht die Welt voller Geschichten ist, sondern mein Kopf ihr immer neue andichtet, weil er scheinbar davon besessen ist, dem Leben Bedeutung zu geben. Dabei braucht er doch nur auf den Bauch zu hören, der sagt: Bedeutend ist, was du bedeutend nennst. Oder ist das wieder nur eine Geschichte, die schon morgen ohne Bedeutung ist?
Es war der Beginn eines sonnigen Septembertages in Lower Manhattan…
Entwurf von Regeln für das Durchschreiten von Parkanlagen
Oskar, ein Hagestolz noch nicht zu alten Datums, ist von der tiefen Überzeugung durchdrungen, dass Regeln dazu da sind, eingehalten zu werden. Die Welt ist ein wohlgeordnetes Universum, das mathematischen Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Wenn diese noch nicht ausreichend erforscht und durchdrungen sind, gilt es, sich mit Verhaltensregeln zu behelfen, um der wohlgeordneten Ordnung der Welt nicht im Wege zu stehen. Dies ist, grob umrissen, Oskars Postulat für eine wohlgeordnete Welt.
Um seinem Kopf ein wenig Erholung von seiner Studierstube zu geben, war Oskar in den Park gegangen. Dort fand er, am Beginn eines neu angelegten Weges, folgendes Schild vor:
Zweifellos handelt es sich hier um eine Verhaltensanweisung, die Oskar nun, gemäß seines Postulats einer wohlgeordneten Welt, gewillt war zu befolgen. Doch er sah sich mit einer großen Schwierigkeit konfrontiert, was die Befolgung der Verhaltensanweisung betrifft: Was ist Schrittgeschwindigkeit, wie definiert sie sich? Die Menschen gehen unterschiedlichen Schrittes: schleichenden Schrittes, laufenden Schrittes, zum Beispiel. Überhaupt bietet Sprache hier keinen Anhaltspunkt. Denn würde auf dem Schild spezifiziert stehen Schleichende Schrittgeschwindigkeit, so böte das wieder unendliche Interpretationsmöglichkeiten. Was für den einen ein Schleichen ist, ist für den anderen bereits rasende Geschwindigkeit. Es würde einzig und allein eine präzise mathematische Angabe helfen, mit welcher Geschwindigkeit man den Weg zu durchschreiten habe, wobei man hier wieder einen präzisen Geschwindigkeitsmesser bei sich haben müsste, um sicher zu gehen, den Weg nicht mit zu niedriger oder zu hoher Geschwindigkeit zu durchschreiten. Kann man der Bevölkerung zumuten, sich für ihre Parkspaziergänge einen Geschwindigkeitsmesser zu besorgen, um die Wege mit der vorgegebenen Schrittgeschwindigkeit zu durchschreiten?
Oskar fühlte sich im Stich gelassen. Was soll diese unpräzise Verhaltensanweisung auf dem Schild vor ihm, die er sich unfähig fühlte zu befolgen! Kurz überlegte er, ob er den Weg laufenden Schritts durchschreiten sollte, um so die Zeit zu vermindern, in der er einer externen Beobachtung einer eventuellen Regelwidrigkeit ausgesetzt war. Er streckte seinen Hals und schaute kurz den Weg entlang, für den die unpräzise Verhaltensanweisung galt. Er konnte kein Ende der Verhaltensanweisung erspähen. Also unterließ er es, den Weg laufenden Schrittes zu durchschreiten, da ihn die Vorstellung zu sehr beunruhigte, eine langandauernde eventuelle Regelwidrigkeit zu begehen. Es bestünde dann ein erhöhtes Risiko, dass ihn ein externes Regelorgan wie etwa ein Polizist dabei ertappte. Es würde schwierig sein, diesem sein Verhalten zu erklären, da er ja nicht einmal für sich hinreichend würde falsifizieren können, keine Regelwidrigkeit begangen zu haben.
Oskar machte kehrt und ging nachhause. Zuhause setzte er sich sogleich an seinen Schreibtisch und begann einen Aufsatz zu schreiben mit dem Titel: Entwurf von Regeln für das Durchschreiten von Parkanlagen.
Walentin Worderbrandner
Ich kam zur Tür herein und Vorderbrandner schaute mich missmutig an. Er sagte: „Ich zweifle an der Sprache – an ihrer Fähigkeit, irgendetwas zu sagen.“
„Ich weiß.“
„Was? Du weißt?“
„Heute ist Donnerstag, Redaktionstag, da zweifelst du regelmäßig an der Sprache, weil du etwas Geschriebenes liefern sollst.“
„Das meine ich nicht. Ich meine es wirklich ernst diesmal mit dem Zweifel. Gut dass du Geschriebenes erwähnst: Ich meine nämlich vor allem die geschriebene Sprache, an der ich zweifle. Wie kann etwas Geschriebenes etwas aussagen, wenn es sich durch nichts ausdrücken kann als durch Schrift, durch etwas Totes wie Schrift?“
„Weil du mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen hinter dieser Schrift stehst und ihr etwas Lebendiges dadurch gibst.“
„Danke für die Belehrung, Herr Oberlehrer!“
„Du hast Recht. Ich wollte gerade etwas Weises sagen. Meist kommt Wirres dabei heraus. Aber es ist egal. Wichtig ist doch nur, welches Bild in meinem Kopf ist, das ich transportieren will. Ob das Bild, das ich im Kopf habe, beim Leser ankommt, ist eine andere Frage. Es ist als Schreibender bereits ein Riesenerfolg, wenn mein Bild überhaupt gelesen wird und irgendein Bild im Leserkopf kreiert wird.“
„Vielen Dank für das Kurzreferat! Ich betitle es mit: Das Wisuelle.“
„Das gefällt mir, Vorderbrandner: Das Wisuelle. Das ist ein noch viel passender Begriff als Das Bild. Es ist das Ganze: die Gedanken, die Gefühle – ist mir warm, ist mir kalt, bin ich verliebt, bin ich verlassen worden.“
„Das W machts eben – mit V wär es wieder nur ein Bild, das Visuelle.“
„Schön dass dir das W gefällt.“
„Gefallen? Ich arrangiere mich mit deinem W-Tick.“
„Mag sein, dass ich einen W-Tick habe. Aber die Welt hat einen noch viel größeren Tick: einen WWW-Tick. Alles hängt nur noch am Netz. Aber ich muss in der Tat aufpassen mit meinem W-Tick: Erinnerst du dich an Valentina, die mal zu uns stoßen wollte? Die hat es sich dann anders überlegt, als ich ihr mein WWW-Konzept (Weises, Wirres, Wisuelles) erläutert habe, weil sie plötzlich dachte, sie müsste sich fortan Walentina nennen, um mit mir zu arbeiten.“
„Nur deswegen ist sie nicht geblieben?“
„Ich glaube schon. Vielleicht ist es besser. Könnte sein, dass ich wohl nur scharf war auf Walentinas Wagina – oder Valentinas Vagina, das ist mir jetzt einerlei – und nicht auf ihre Schreibkünste.“
„Und sie auf Peters Penis und nicht auf deinen.“
„Vorderbrander, du machst dich! Haben wir deine Zweifel an der Sprache nun ausgeräumt?“
„Ich zweifle, dass ich nicht zweifle.“
„Solange du mir nicht sagst: ‚Ich lebe, dass ich nicht lebe‘, ist alles halb so schlimm. Ich werde dir deine Zweiflereien schon austreiben! An die Arbeit! Und verzeih mir, wenn ich dich ab jetzt manchmal Walentin Worderbrandner nenne!“
Romantisch
München, Balanstraße
Im Stadtteil Haidhausen zweigt die Balanstraße unauffällig und klein von der Rosenheimer Straße ab, wie eine launische Diva, die sich weigert, eine vernünftige Richtung einzuschlagen.
Sie führt nicht nach Rosenheim, schon gar nicht nach Salzburg. Doch wo führt sie hin? Will sie mich auf geheimnisvolle Art verführen? Zunächst lässt sie Ramersdorf links liegen, Giesing rechts. Zwischendurch wird sie sehr breit, weist mehrere Fahrspuren pro Fahrtrichtung auf und ist umringt von großen Gebäuden.
Nach ihrem schmalspurigen Beginn gibt sie mir das Gefühl, etwas Bedeutsamem, Großem auf der Spur zu sein, was meine Neugierde weckt. Weiter draußen aus der Stadt, Ramersdorf und Giesing hat sie hinter sich gelassen, leisten zwei Autobahnen ihr Begleitschutz, eine östlich, eine westlich von ihr gelegen. Beide Autobahnen nehmen ebenfalls Kurs Richtung Süden, wie die Balan. Wird sie sich beeindrucken lassen von diesen mächtigen Gefährten, oder unbeeindruckt ihren Kurs Richtung Süden halten? Sie schmiegt sich näher an die Autobahn 8 links von ihr, so als wüsste sie, dass diese als die Hauptstrecke deklariert ist und die rechts gelegene Autobahn 995 nur als Zubringer. Doch die Balanstraße belässt es bei dieser zarten Annäherung, ohne sich je zu binden. Unbeeindruckt führt sie mich weiter nach Süden.
Trotzig überquert sie in ihrem Verlauf alle Straßen, die sie queren: Orleansstraße, St-Martin-Straße, Claudius-Keller-Straße, Chiemgaustraße, Ständlerstraße. Die Orleansstraße und die Claudius-Keller-Straße sind ob dieser Trotzigkeit so beleidigt, dass sie in ihrem weiteren Verlauf ihre Namen ändern zu Welfen- und Werinherstraße, als Zeichen der Verachtung dieses trotzigen Querulanten. Auch Eisenbahntrassen und der Justizvollzugsanstalt Stadelheim, immerhin einer der größten in ganz Deutschland, trotzt die Balanstraße mit geradliniger Eleganz Richtung Süden.
Weit im Süden, wo sie die Fasangartenstraße überquert, scheint sie jedoch nachdenklich zu werden und ihr eigenes Ende zu ahnen. Sie wird schmal, ein kleines Sträßlein, so wie an ihrem Anfang in Haidhausen. Kleine Häuser lässt sie links und rechts liegen, doch nicht mehr mit trotziger Eleganz, eher mit devoter Bescheidenheit.
Plötzlich endet sie und gibt den Blick frei auf eine weite grüne Wiese, Kapellenfeld genannt. Es geht nicht weiter. Es gibt nur den Blick über das Feld Richtung Süden.
Süden, das scheint das einzige zu sein, was die Balanstraße in ihrem ganzen Verlauf im Kopf hat, wie ein Versprechen leitet sie einen in diese Himmelsrichtung, und jetzt, am Kapellenfeld, bleibt nur die Sehnsucht danach.
Nach dem Kapellenfeld ist Unterhaching, nach Unterhaching vereinigen sich die beiden Autobahnen 8 und 995 beim Kreuz München-Süd. Die Balanstraße hat weise entschieden, am Kapellenfeld zu enden. Weshalb Unterhaching mühsam durchqueren, vielleicht unter Kompromissen diese geradlinige und konsequent südwärtsgewandte Richtung aufgeben, um dann von zwei Autobahnen verschluckt zu werden? Dann lieber hier enden, am Kapellenfeld, in stiller Erhabenheit, und mit dem weiten Blick Richtung Süden für das, was da noch kommen mag.
Das Au-Tor
und die Torheit des Autors
Ich lief durch die Gegend und überlegte, was ich aufschreiben soll. Soll ich aufschreiben, was ich erlebe, oder soll ich erleben, was ich aufschreiben will?
Völlig in diese Gedanken versunken stieß ich gegen ein Tor.
Au! rief das Tor, du hast mir weh getan!
Als ich wieder zu mir kam, sah ich die Beule im Tor und sagte zu ihm: Au, das hat weh getan. Du hast sicher Schmerzen. Und da ich nicht wusste, ob das Tor weiß, was Schmerzen sind, sagte ich weiter: Du bist jetzt ein Au-Tor.
Und du bist ein Tor, dass du einfach so gegen mich rennst, erwiderte das Au-Tor. Deine Torheit stinkt zum Himmel!
Nein. Ich bin ein Autor, entgegnete ich, auf der Suche nach etwas zum Schreiben. Und selbst wenn ich ein Tor bin – schon Erasmus von Rotterdam schrieb: ein Lob der Torheit!
Das Au-Tor schien mich nicht zu verstehen, jammerte und klagte stattdessen.
Kann ich dir helfen, Au-Tor, deine Schmerzen zu lindern?
Ja, sagte das Au-Tor. Du kannst ein Werkzeug holen, um meine Beule auszuklopfen.
Auf der Suche nach einem Werkzeug, um die Beule des Au-Tors auszuklopfen, fand ich ein Mark-Stück. Da fiel mir wieder ein, was ich aufschreiben wollte: Ich wollte etwas über das Gesichtsbuch-Unternehmen des Mark Zuckerberg schreiben. Bevor ich jedoch dazu Weiteres schreibe, will ich mich diesem Thema zunächst nur bildlich nähern, da ich jetzt die Beule des Au-Tors ausklopfen werde:
Treffen in der Dämmerung
In Salzburg stehen zu viele Kirchen
Etwas trieb mich hierher, obwohl ich Grübeldinger seit Jahren nicht gesehen habe. Grübeldingers Bruder hat mich angerufen, und ich habe daraufhin den nächsten Zug nach Salzburg genommen.
Grübeldinger hat immer gesagt, in Salzburg stehen zu viele Kirchen. Oben auf dem Mönchsberg, den er fast täglich beschritten hat, hat er sie gezählt, immer wieder, die Salzburger Kirchen. Er hat gesagt: Ich kann einen Gott, der in diesen Kirchen wohnt, nicht lieben. Aber ich bin gezwungen, diesen Gott zu lieben, der in diesen Kirchen wohnt. Etwas in mir zwingt mich, diesen Gott zu lieben. Eines Tages werde ich es nicht mehr aushalten, diesen Gott zu lieben, dann werde ich mich von hier, vom Mönchsberg, auf die Kirchen stürzen. Ich sagte ihm, er solle öfter zur Richterhöhe gehen, auf die andere Seite des Mönchsbergs, um von dort nach Süden zu blicken, raus aus der Stadt. Das geht nicht, sagte Grübeldinger, denn wenn er nach Süden blickt, dann sieht er die Schlösser, die sich die prunksüchtigen Erzbischöfe gebaut haben. Einmal sei er auf die Richterhöhe gegangen, und als er von dort Schloss Hellbrunn erblickte, hat er einen Wutanfall bekommen und laut zu schreien begonnen. Hellbrunn, sagte er, sei der Gipfel der Heuchelei, wodurch sich die Erzbischöfe schließlich verraten hätten. Denn in den Kirchen von Gott zu predigen, dem sich jeder zu unterwerfen habe, und in Hellbrunn den weltlichen Freuden zu frönen, das hätte ihnen das Volk nicht mehr abgenommen, sagte Grübeldinger, und das Volk hätte zu zweifeln begonnen, ob es an diesen Gott glauben soll, denn das Volk hat erkannt, dass dieser Gott nur vorgeschoben war, um es ruhig zu halten. Doch das Volk heute, sagte Grübeldinger, ist auch nicht viel gescheiter, nur dass die Mächtigen heute nicht mehr Erzbischöfe heißen, und dass sie den Gott, von dem sie sprechen, nicht mehr Gott nennen.
In jedem Fall, sagte Grübeldinger, bin ich seit diesem Wutanfall nicht mehr auf die Richterhöhe gegangen und beabsichtige auch nicht, es noch einmal zu tun. Stattdessen versuche ich seitdem, so nahe wie möglich an der stadtzugewandten Seite des Mönchsbergs zu spazieren. Ich versuche, bei diesen Spaziergängen immer wenigstens einen der vielen Kirchtürme zu sehen, denn so sehr ich die Kirchen auch hasse, in denen der Gott wohnt, den ich so hasse, weil ich dabei an die Erzbischöfe denken muss, so beruhigen mich andererseits diese Kirchen auch, denn hier bin ich geboren, und ich kenne nichts anderes als diese Kirchen, sagte Grübeldinger. So sehr sie ihn auch einengen, so sehr benötige er sie. Neulich habe er sich oben am Mönchsberg durch Bäume und Gebüsch geschlichen und habe eine Stelle entdeckt, wo er in die Tiefe blicken konnte zum St.-Peters-Friedhof. Er sei ganz ruhig gewesen, dort oben, beim Blick in diese Tiefe, habe aber trotzdem überlegt, ob dies der Moment sei, um in die Tiefe zu springen. Aber etwas zwang mich, es nicht zu tun, sagte er.
Ich blicke hinauf zur steilen Felswand und überlege, wo Grübeldinger wohl gestanden hat. Auch ich bin, wie Grübeldinger, in Salzburg geboren, doch ich bin schon lange weggezogen. Waren es die vielen Kirchen, die mich veranlassten wegzuziehen? Ich sagte Grübeldinger, er solle doch wegziehen, zumindest für eine Weile, um etwas Abstand von den Kirchen zu bekommen. Oder mich in München besuchen. Grübeldinger sagte, in München seien die Kirchen noch viel schlimmer, weil sie sich mehr verteilten als hier in Salzburg und die ganze Gegend weitläufig infiltrierten. Hier in Salzburg hingegen stünden sie konzentriert, eingezwängt zwischen Mönchsberg und Salzach. Hier in Salzburg könne er die Wesensart der Kirchen besser studieren, durch ihre Eingezwängtheit. Hier könne er den Gott, den die Erzbischöfe geschaffen haben, besser studieren, da der Gott hier gefangen sei in seiner eigenen Prunksucht. Ich sagte Grübeldinger, er solle doch einmal über die Salzach gehen und am anderen Ufer auf den Kapuzinerberg gehen, um mit etwas Abstand auf die Stadt und ihre Kirchen zu blicken. Grübeldinger erwiderte, das komme für ihn nicht in Frage, denn er wolle in Zukunft immer so nahe wie möglich an der stadtzugewandten Seite des Mönchsbergs spazieren, denn nur so könne er die Kirchen durchdringen, könne diesen Gott begreifen, der von den Erzbischöfen geschaffen wurde. Ich habe Angst vor diesen steilen stadtzugewandten Schluchten, sagte Grübeldinger. Er sei sicher, dass nur hier, in diesen dunklen Schluchten, die Erzbischöfe diesen Gott erschaffen konnten, während sie selbst, die Erzbischöfe, aus diesen dunklen Schluchten nach Hellbrunn geflüchtet seien, weil dieses dunkle Leben in diesen Schluchten nicht zu ertragen sei, sagte Grübeldinger. Deshalb spaziere er jeden Tag auf den Mönchsberg, um vor diesen dunklen Schluchten zu fliehen, aber dennoch gehe er immer ganz nah an diesen dunklen Schluchten entlang. Etwas zwinge ihn, dies zu tun. Zur Richterhöhe könne er nicht gehen, denn dort sieht er Hellbrunn, und das sei noch viel schlimmer als die Kirchen zu sehen. Der Anblick von Hellbrunn beunruhigt mich, während der Anblick der Kirchen mich beruhigt, sagte Grübeldinger.
Ich hatte Grübeldinger lange nicht gesehen, jahrelang, weil ich genug hatte von seinem Kirchenwahnsinn. Für Grübeldinger gab es nichts anderes als die Salzburger Kirchen, und als ich ihm noch einmal vorschlug, er solle die Salzach überqueren, auf den Kapuzinerberg gehen und von dort, mit etwas Abstand, Salzburg und seine Kirchen betrachten, sagte er, das würde er nicht aushalten, die Stadt und ihre Kirchen in der Totalen zu sehen, genauso wenig, wie er es aushält, von der Richterhöhe Hellbrunn zu sehen. Die Stadt vom Kapuzinerberg zu sehen würde ihn sicher sehr beunruhigen, da sei er sich sicher, während es ihn beruhigt, die Stadt und die Kirchen von oberhalb der stadtzugewandten Schluchten des Mönchsbergs zu sehen, denn hier sei er den Göttern nahe, mit denen die Erzbischöfe die Stadt infiltriert hätten. Diese Götter seien sein Leben und sein Tod zugleich.
Grübeldingers Bruder sagt, dass Grübeldinger in letzter Zeit nicht mehr so oft auf den Mönchsberg gegangen sei, und dass es daher völlig absurd sei, dass er sich jetzt vom Mönchsberg in den St.-Peters-Friedhof gestürzt hat, jetzt, wo er nicht mehr so oft auf den Mönchsberg gegangen sei wie in all den Jahren zuvor.
Ich weiß nicht, wieso ich gekommen bin. Ich habe Grübeldinger seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe ein Taxi genommen und bin vom Bahnhof sofort zum St.-Peters-Friedhof gefahren, wo Grübeldingers Bruder auf mich gewartet hat. Ich stehe inmitten der Gräber, blicke hinauf zur steilen Felswand und stelle mir vor, wie Grübeldinger sich in den St.-Peters-Friedhof gestürzt hat, umgeben von den Kirchen seiner Götter.
Ausflug aufs Land (München-Pasing)
Emil, ein Hagestolz noch nicht zu alten Datums, möchte der Enge seiner städtischen Bleibe entfliehen und für ein paar Tage aufs Land fahren. Von einem werten Kollegen hat er gehört, dass zu Pasing, westlich der Stadt gelegen, vor längerer Zeit ein Architekt eine geschmackvolle Villensiedlung im Grünen errichten ließ. Emil fährt mit der Bahn nach Pasing. Dort angekommen, verlässt er den Bahnhof Richtung Norden und findet sich in der August-Exter-Straße wieder. Hier muss es sein! Denn so hieß er, der Architekt, der hier auf grünem Land die Villen plante und errichten ließ: August Exter. Emil fühlt sich oft verbunden mit Menschen, nach denen Straßen und Plätze benannt werden. Zu oft, findet er, kommt die Würdigung bedeutender Menschen zu kurz, im Allgemeinen wie im Besonderen.
Emil geht die August-Exter-Straße entlang und sieht ein paar durchaus prächtige Gebäude. Doch insgesamt ist es ihm zu geschäftig, als dass herrschaftliche und erhabene Gefühle aufkommen könnten. Er will die Straße überqueren und wird dabei fast von einem schnöden Omnibus überfahren, der hier auch noch durchfährt. Hier will er nicht wohnen. Das ist kein landschaftliches Wohnen, das er sich vorstellt. Er beschließt, auf die Suche nach ruhiger gelegenen Villen zu gehen. Er sieht einen Herrn mit Hut und Spazierstock aus einer Seitenstraße spazieren, dessen Noblesse ihm geeignet erscheint, ihn für einen Villenbesitzer zu halten. „Verzeihung, mein Herr: Ich bin auf der Suche nach einer ruhigen Villa im Grünen; einer Villa, in der selbst der gesegnete Herr Exter mit seiner anvertrauten Gattin Luise gerne gewohnt hätte.“ Emil präsentiert stolz das Wissen über die Extersche Familie, das er sich angeeignet hat. „Da lang ist der Luisengarten, wenn Sie den meinen“, sagt der etwas verwundert dreinblickende Herr und zeigt auf die Seitenstraße, aus der er gerade gekommen ist. Emil geht die Seitenstraße entlang: Luisengarten, das ist gut – sicher benannt nach der Gattin des Herrn Exter.
Emil kommt an eine bayrische Wirtschaft, den Luisengarten. Da es noch warm ist, lässt er sich unter der Kastanie nieder. Er sitzt da und träumt davon, mit August Exter und Luise am Tisch zu sitzen und um die Hand einer der drei Exter-Töchter anzuhalten: Eva, Gabriele, Klara – eine schöne als die andere in seinem Kopf. Welche soll er nur nehmen? August Exter ist schon lange tot. Seine Frau auch. Seine Töchter noch nicht so lange, aber tot sind sie auch. Doch Emil lässt sich nicht beirren: Er will eine Villa finden, dort wohnen und von den schönen Exter-Töchtern träumen. Er fragt den Wirt, wo es denn hier eine von Exter erbaute Villa gebe, die ruhig und im Grünen liegt. Er, der Wirt, könne ihm doch sicher helfen, als Besitzer einer Wirtschaft, die nach der hochgeschätzten Luise Exter benannt ist. Der Wirt schweigt, sieht Emil prüfend an, meint dann: „Gehen Sie die Straße weiter, da kommen Sie an den Nymphenburger Kanal. Da ist es grün.“ „Danke“, sagt Emil und erhebt sich vom Tisch. „Und für was brauchen Sie eine Villa?“ „Zum Wohnen.“ Emil geht locker-beschwingt aus dem Wirtsgarten hinaus und weiter die Straße entlang.
Kurz vor dem Kanal mit seinem begrünten Ufer sieht er linkerhand eine schöne Villa in einem großzügigen Garten stehen. Er ist begeistert. Hier will er wohnen! Er geht zum Gartentor und klingelt. Er blickt über den Zaun und bewundert das Anwesen. Ruhig und im Grünen, sehr stilvoll. Hier will er wohnen! Er klingelt ein zweites Mal. Er versucht, die stilistischen Merkmale der Villa architektonisch einzuordnen. Doch sein Enthusiasmus weicht jäh der Ernüchterung. Noch immer öffnet niemand die Tür. Ist niemand zuhause oder hat man beschlossen, ihn am Gartentor stehen sehend, nicht einzulassen? Emil wird unsicher. Soll er nochmals klingeln? Er sieht seinen Traum vergehen, hier in dieser Villa zu wohnen. Ach Eva, ach Gabriele, ach Klara! Womit habe ich das verdient!
Wie ein Geschlagener trottet er die Seitenstraße zurück. In der August-Exter-Straße angekommen und auf den Bahnhof zugehend, spricht ihn eine Frau an, die gerade auf den Omnibus wartet: „Junger Mann, Sie sehen so niedergeschlagen aus. Kann ich Ihnen helfen?“ „Ich wollte in einer Villa wohnen, aber niemand war zuhause.“ „In welcher Villa?“ Emil zeigt in die Seitenstraße: „Beim Luisengarten vorbei, am Kanal.“ „Aber die Villen, die stehen doch stadtauswärts, über der Würm“, sagt die Frau. „Stadtauswärts, über der Würm?“ „Ja. Biegen Sie vor dem Bahnhof rechts ab und überqueren Sie anschließend die Pippinger Straße. Da stehen Sie dann, die Villen, in der Alten Allee und der Marschnerstraße.“ „Von August Exter erbaut?“ „Das weiß ich nicht. Kann schon sein.“ „Vielen Dank Luise!“ sagt Emil mit einem Ausruf des Entzückens und will die Frau am liebsten umarmen. „Nichts zu danken. Aber – ich heiße nicht Luise.“ „Natürlich nicht. Entschuldigen Sie, Eva! Und grüßen Sie Gabriele und Klara von mir!“ Emil marschiert schnell weiter. Die Frau, deren wahren Namen wir nicht erfahren, bleibt so verwundert stehen, dass sie vor Verwunderung den Omnibus ohne sie abfahren lässt.
Emil steht an der Pippinger Straße und ist aufgrund des vielen Verkehrs gezwungen zu warten, bevor er sie überqueren kann. Gegenüber beginnt sie, die Alte Allee. Er sieht zwei alte Villen. Die müssen wohl von Exter sein. Sie sind von Verkehr umtost. Wie Relikte aus vergangenen herrschaftlichen Zeiten stehen sie da. Das ist kein landschaftliches Leben, von dem er träumt. Als er endlich die Pippinger Straße überqueren kann, geht er hurtig an den verkehrsumtosten Villen vorbei. Er gelangt zu einer Kirche. Rechts von ihr geht die Alte Allee weiter, links beginnt die Marschnerstraße. Von beiden Straßen hat die Frau gesprochen, deren wahren Namen wir nicht erfahren haben. Welcher Straße soll Emil entlanggehen? Er entscheidet sich für die Alte Allee. Aus einem Gefühl heraus. Alte Allee klingt erhaben. Hier würde er seine Villa für das Landleben finden. Emil fallen vor allem die alten Bäume an der Alten Allee auf. Es gibt einige Villen, linkerhand, doch es gibt nach wie vor diesen Verkehr, der Emil stört. Rechterhand tut sich eine unbebaute, freie Wiese auf, an deren anderem Ende eine Kirche steht. Emil misst der Entfernung zur Kirche eine Strecke von dreihundert Metern bei. Hier noch einmal so stehen wie Exter, vor dem unbebauten Land, und im Kopf die Villen planen! Emil geht weiter und kommt an einem eher armseligen, kleinen Häuschen vorbei, das einen Outdoor-Shop beherbergt. Soll er sich ein Zelt kaufen und es wie ein Pionier auf der Wiese aufschlagen? Dreihundert Meter freie Sicht nach Osten. Die Sonne würde ihn früh am Morgen erreichen und ihn beleuchten wie einen König der Landschaft.
Doch dann denkt er an die Autos, die aus den Seitenstraßen in die Alte Allee abbiegen und mit ihren Lichtkegeln in der Dunkelheit sein Zelt beleuchten. Er verwirft die Idee. Allmählich bekommt er Hunger. Dieses Landleben beziehungsweise das Suchen nach ihm ist anstrengend. Er blickt die Alte Allee entlang und glaubt zu erkennen, dass sie wohl in einem knappen Kilometer einen Rechtsknick beschreibt, folglich nach einem Kilometer noch immer nicht zu Ende ist. Würde er hier seine Villa finden? Zaghaft geht er ein paar Schritte weiter. Linkerhand sieht er eine Wirtschaft namens Jagdschloss. Er spürt Wut in sich aufkommen über diesen Namen. Wie soll man in diesem Trubel eine Jagd veranstalten? Wer hier das Jagdhorn bläst, verhallt ungehört ob des Autolärms. Er denkt kurz nach, ob wohl die Marschnerstraße eine ruhigere Straße sei, eine Straßen mit vielen noblen Herren in ihren herrschaftlichen Villen. Doch dann hat er nur noch ein Bedürfnis: Nachhause zu fahren, in die Behaglichkeit seiner Stadtwohnung, um sich zu erholen, von diesem anstrengenden Ausflug aufs Land.