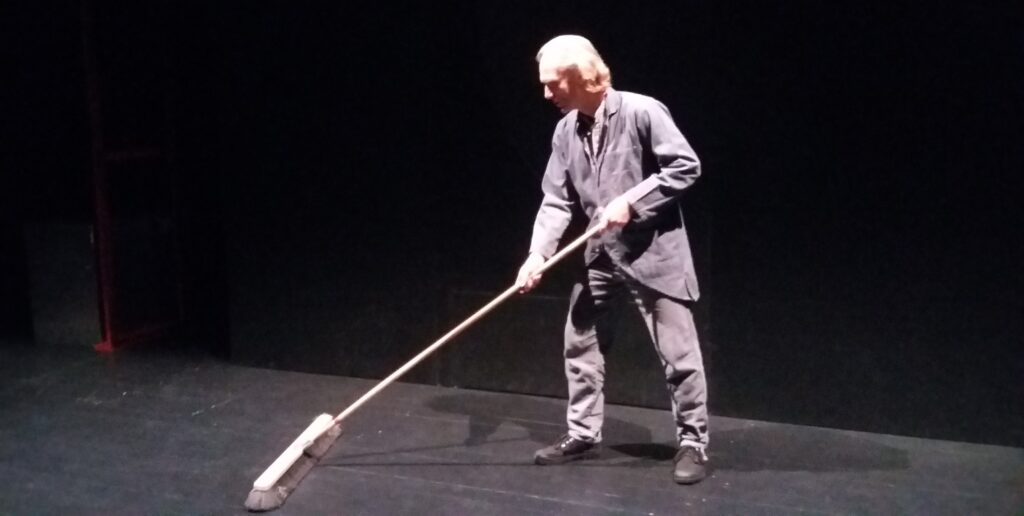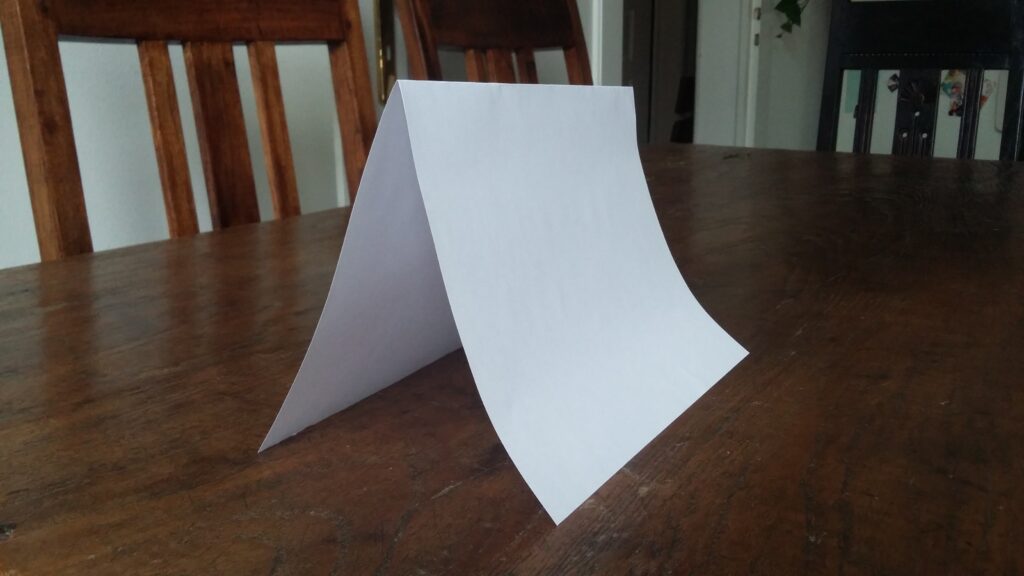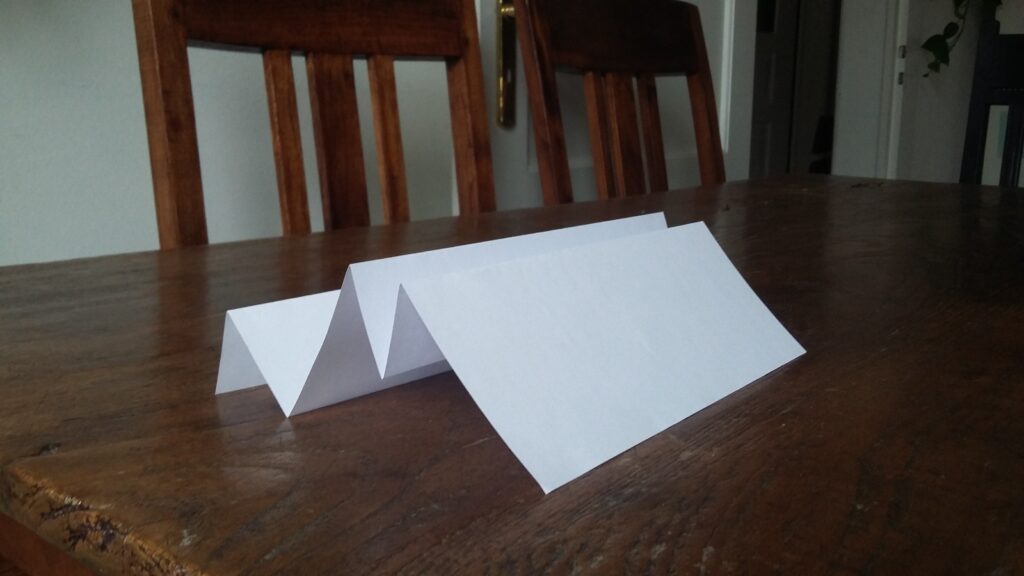Die Flaneuse flaniert in Flanell, jetzt, im Winter, wo es kalt ist.
Im Sommer dagegen, als es warm war, saß sie mit einigen Anderen in einem Raum, als einer der Anderen sagte: „Würden Sie sich bitte bekleiden! Nacktheit im Beisein von Anderen entspricht nicht meiner Moral.“ Woraufhin sich die Flaneuse erhob und sagte: „Wenn ich das Wort Moral höre, muss ich den Raum verlassen.“ Ich wusste nicht, dass sie mit diesem Satz Kieślowski zitierte, jetzt weiß ich es, ich glaube die Flaneuse selbst hat mich später darauf hingewiesen, dass sie Kieslowski zitierte, er sprach über seinen Dekalog, ein ethisches und kein moralisches Werk, wie sie betonte, jedenfalls ging die Flaneuse, nachdem sie Kieślowski zitiert hatte, zur Tür die ins Freie führt, und als sie die Tür geöffnet hatte, in ihr stand und bevor sie sie hinter sich schloss, sagte sie: „Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg.“ Dann ging sie aus der Tür, schloss sie hinter sich und ließ die Anderen im Sarg zurück.
Ich kenne die Geschichte, weil ich daraufhin der Flaneuse begegnete, wie sie nackt die Straße entlangflanierte. Freudig begrüßte sie mich und meinte, sie habe soeben Blumfeld zitiert mit Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg, und die Anderen im Sarg belassen, während sie nun die Freiheit im Freien genieße, sicher, meinte sie weiter, der harte Asphalt unter meinen Füßen passt nicht zur Weichheit meiner Haut, ich träume vom weichen Wiesengrund, der mich zum wilden Wasser führt, der weiche Wiesengrund ist eine kulturelle Errungenschaft, während der harte, knorrige, wurzelige Waldboden die Realität ist, eine Realität vor dem Menschen, sofern man in der menschlichen Welt von Realitäten sprechen kann, mir erscheint alles wie ein Traum, meinte die Flaneuse, und sie fügte an, dass der harte, knorrige, wurzelige Waldboden mit weichem Moos durchsetzt sei, woraufhing sie vorschlug, den harten Asphalt der Stadtstraßen zu verlassen und in den Stadtwald zu gehen, um dort auf weichem Moos zu ruhen.
Wir flanierten nun zu zweit die Straßen entlang, wobei: Bei mir war es eher angespanntes Gehen, ich sah in den Augen entgegenkommender Leute deren Moral aufblitzen, als ich mit der nackten Flaneuse die Straßen entlangging, ich war kurz davor, vor dieser Moral zu kapitulieren, doch die Flaneuse setzte unbeirrt einen Schritt vor den anderen, dieser Unbeirrtheit konnte ich mich nicht entziehen. Ich begann aber – wohl, um mich von meiner eigenen Moral abzulenken – unentwegt zu plappern, irgendwelches Zeug, sodass ich mich – das weiß ich erst jetzt, im Nachhinein – den wunderbaren Welten, die die Flaneuse mir eröffnet hatte, zu entziehen begann.
Ich wünschte wir wären gemeinsam im Stadtwald angelangt, wo ich mich spätestens auf weichem Moos ebenfalls entkleidet hätte, um mit der Flaneuse unter offenem Himmel die wunderbaren Welten zu erkunden. Doch dazu ist es nicht gekommen: Ich ließ die Flaneuse allein weiterflanieren, bog selbst hart in eine Seitenstraße ab, um mich meiner Moral zu ergeben.
In dieser harten Seitenstraße, die im Winter noch härter ist, flaniert sie nun, die Flaneuse, in weichen Flanell gepackt. Ich sehe sie gehen, wie sie einen Schritt vor den anderen setzt, ich fühle mich wie in einem Sarg, unfähig, einen Schritt mit ihr zu gehen, und wie ich sie so gehen sehe, weiß ich nicht: Ist es ein Traum, oder ist es die Realität der ich nicht ins Auge blicken kann?
„Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg“