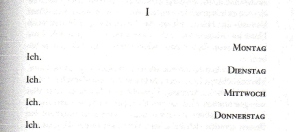Das Meer und der Marmor, dazwischen das Grün. Bald ist der Hafen erreicht, ganz leicht. Ein Schiff wird kommen, nimmt uns mit. Vorne stehen auf dem Bug und die wogenden Wellen spüren. Der Blick auf das Ziel, auf die Insel, die Insel meiner Träume und du neben mir. Die Sonne wird tiefer, das Ziel rückt näher. Das Leben ist schön. Ich will so viel sagen, genau deshalb sage ich nichts. Es reicht mir mein Blick in deine Augen und ich sehe das Meer in dir. Das Meer in dir bringt uns auf unsere Insel. Du und ich.
Archiv der Kategorie: Weises
Ich weiß, dass ich nicht weiß. Ist das schon weis?
Besorgungen eines Mannes, der Ruhe sucht
Einen ruhigen Ort aufsuchen, um dort zu ruhen, um dort zu mir zu kommen, und dann voller Kraft ins Leben zurückkommen. Das will ich tun!
Doch mich beschleicht der Zweifel: Es könnte zu ruhig sein an diesem Ort. Eine Frau soll mitkommen. Doch welche? Ich muss sie mir wohl vorher besorgen. Also Frau besorgen.
Einer Frau muss man etwas bieten. Geld, Einkommen, Status. Also muss ich mir zunächst einen Job besorgen, der mir Geld, Einkommen und Status bringt. Danach erst kann ich eine Frau besorgen.
Doch kann ich mir ohne die Zuneigung einer Frau einen Job besorgen? Es dreht sich alles im Kreis und ich bekomme keinen Fuß auf den Boden. Das Wirtschaftssystem, die Wertschöpfung, die Ausbeutung, die Ideen der Menschheit. Große Gedanken in meinem Kopf, die Unruhe erzeugen, anstatt Ruhe. Ich wollte doch ruhen!
Ich werde einen ruhigen Ort aufsuchen. Ohne Frau, ohne Job. Einfach so. Besorgungen später.
Schweigeminuten
Der Regen an diesem Morgen hat ihr Drehbuch geschrieben. Er und sie stehen am Bahnsteig der U-Bahn. Er versucht zu reden. Ganz deutlich höre ich Worte, die seine Lippen passieren. Doch es bleibt bei den Versuchen, denn seine Worte kommen nicht an. Wie hilflose Versuche einer Kontaktaufnahme entfliehen sie in die Weite des Seins.
Sie sagt ja.
Ja.
Nach ein paar Worten von ihm sagt sie wieder: Ja…
Ja.
Ihre Augen sind groß und fragend hinter der dicken Brille, so als bitte sie ihn inständig: Hör bitte zu reden auf! Deine Worte sind bedeutungslos. Sie bedeuten nichts. Nichts, nichts.
Die U-Bahn kommt, und ich habe das Glück, im Waggon direkt neben ihnen zum Stehen zu kommen. Sie reden nichts. Doch jetzt erzählen sie sich große, bedeutungsvolle Geschichten:
Seine Augen so traurig, voller Enttäuschung. Ihre Augen groß und fragend hinter der dicken Brille. Die Sehnsüchte im Raum unendlich. Ich und die vielen anderen im Waggon lauschen ihnen andächtig und gespannt.
Seine Augen sagen: Lass uns über weite grüne Fluren tanzen, wo die Sonne scheint und wir glücklich sind!
Ihre Augen sagen: Weite grüne Fluren? Du glaubst doch wohl nicht an weite grüne Fluren?
Seine Augen sagen: Ja, du hast recht. Ich glaube nicht an weite grüne Fluren. Ich bin ein Mann des Regens, obwohl ich solche Sehnsucht nach der Sonne habe.
Ihre Augen sagen: Ich habe mir so sehr gewünscht, dass du mir jetzt sagst, dass du an sie glaubst, an die weiten grünen Fluren, über die wir tanzen. Aber wieder sagst du mir, dass du nicht an sie glaubst, an die weiten grünen Fluren.
Die Sehnsüchte bleiben hängen, tragisch, unerfüllt. Ich würde ihm gerne eine Regieanweisung geben: Nimm ihr die Brille ab, und dann schaue ihr ganz tief in die Augen, bis sie sie sieht, die weiten grünen Fluren in dir!
Aber ich bin nicht zuständig für das Drehbuch ihres Lebens.
Der Applaus für das Drama bleibt aus an der nächsten Haltestelle. Es ist nicht zum Lachen. Und doch hat sich das Leben ruhig verraten, in diesen Schweigeminuten.
Gombrowicz hat gesagt
Latschenkiefernöl
„Ich mag den Duft von Latschenkiefernöl“, habe ich zu dir gesagt. Du hast gelächelt. Dieser Moment, er war schön, als ich zu dir gesagt habe, dass ich ihn mag, den Duft von Latschenkiefernöl.
Jetzt flehe ich dich an und sage: „Ich mag mich nicht. Rette mich vor meinem Ich! Du! Du! Du! Rette mich vor meinem Ich!“ Du stehst auf und gehst. Du gehst langsam und gelassen, aber du gehst. „Du kannst doch jetzt nicht gehen“, rufe ich dir nach, „jetzt, wo ich so verzweifelt bin!“ Aber das beeindruckt dich nicht.
Ich brauche Rat, denn ich weiß nicht, was ich nun tun soll mit meinem Ich. Ich raffe mich auf und suche Rat. Der erste Rat sagt: „Steh um sechs Uhr auf und mache sechs Ich-Übungen, so entdeckst du dein Ich.“ „Nein“, ruft da gleich der zweite Rat: „Sage alle zehn Minuten zehnmal Ich, so findest du dich!“ „Nein“, ruft der dritte Rat dazwischen: „Gehe abends in den dunklen Park und rede mit den Bäumen, die führen dich zu deinem Ich.“ Plötzlich bin ich umzingelt von Räten, und sie schlagen auf mich ein; denn das ist ja ihre Aufgabe: Rat-Schläge zu geben. „Wir meinen es nur gut mit dir!“ rufen sie, und schlagen und schlagen und sind in einem regelrechten Rausch. Und ich werde immer weniger ich.
Ich halte es nicht mehr aus. Ich flüchte. Ich laufe so schnell ich kann. Ab und zu möchte ich stehenbleiben und einen Rat erfragen, doch kaum werde ich langsamer, kommen wieder die Schläge über mich und ich laufe erschrocken weiter. Sie hören nicht auf, die Räte, den Weg zu säumen und mir Rat-Schläge zu geben. Um den Schlägen endgültig zu entfliehen, fasse ich meinen ganzen Mut zusammen und springe. Ich springe mitten ins Ungewisse meines Ichs…
.
.
.
Das Wasser ist warm, in dem ich treibe. Ich recke und strecke meinen Körper und sage nur: „Ich Ich Ich.“ Das Wasser duftet nach Latschenkiefernöl. Da sehe ich dich. Du beschenkst mich mit dem Duft von Latschenkiefernöl, weil du weißt, dass ich ihn mag, den Duft von Latschenkiefernöl. Ist das schön, mit dir zu treiben im warmen Wasser! Durch dich habe ich mir mein Ich neu geschenkt. Ich berühre dich und sage: „Du Du Du“ und „Ich Ich Ich“, weil ich jetzt weiß, wie das geht: sich zu lieben.
Wundervoller Morgen
Ein Wintermorgen, kalt und stechend die Luft. Die Sonne sendet erstes schwaches Licht hinter den verschneiten Ästen der Bäume. Ich biege ein in die lange Straße mit den Häusern, dicht an dicht gestaffelt. Die Straße liegt gebettet wie in einen Rhythmus an diesem Morgen; in keinen lauten, krachenden Rhythmus, sondern in einen ruhigen, tragenden. Ich denke an das Adagio in G-Moll nach Albinoni.
Ich tauche ein in diesen Rhythmus. Die Häuser ziehen links und rechts an mir vorbei. Wieviele Stunden hat es gebraucht, all diese Häuser zu bauen? Wieviel Geschick und Handfertigkeit? Ist es nicht ein Wunder, was der Mensch alles erschafft? Er schafft moderne Höhlen, die er Häuser nennt, die wie steile Schluchten die Straßen säumen.
Da ist die Treppe zur U-Bahn vor mir. Ich werde die Treppen hinuntersteigen in den ausgegrabenen Untergrund, in einen Zug einsteigen, der mich durch lange Tunnel an einen Ort bringt, wo ich dann wie von Zauberhand hingebracht wieder an die Oberfläche gelange.
Ich sehe sie die Treppen hinuntersteigen. Sie trägt Kopfhörer und hat ihr Smartphone in der Hand. Ich folge ihr. Sie biegt um die Ecke und fährt die Rolltreppe hinunter zum Bahnsteig.
Wir warten auf den Zug. Ab und zu blicke ich zu ihr hinüber. Ich will ihr erzählen von den Wundern, die ich heute schon erlebt habe: vom orangenen Licht hinter den weißen Zweigen; von den Schluchten, die ich durchschritten habe; von ihr, wie ich sie auf der Treppe gesehen habe und wie wunderbar ich es finde dass sie und ich geboren und auf diese Welt gekommen sind.
Sie blickt kurz zu mir herüber. Doch ehe mir ihr Gesicht etwas sagen könnte, wendet sie sich wieder ab. Will sie mir damit sagen: Hör bloß auf mit deinen Wundern, ich will nichts von ihnen hören?
Vielleicht ist es besser, Wunder einfach geschehen zu lassen, anstatt sie mit schnöden Worten zu beschreiben. Als der Zug kommt, steige ich einen Waggon hinter ihr ein. Und da ist wieder der Rhythmus, ich höre ihn ganz deutlich: das Adagio in G-Moll. Oh Remo Giazotto, hat dir wirklich Tomaso Albinoni diese wunderbare Musik eingeflüstert? Oder ist sie einfach nur wie ein Wunder über mich gekommen an diesem wundervollen Morgen?
Vielleicht passiert es nie (Das Netz)
Du führst mich in deinen reichen Zitate-Wortschatz der Literaturgeschichte. Du hast ein Netz gebaut aus Zitaten und jonglierst auf ihnen. Ich besuche dich auf deinem Netz. Auf einem Netz krabbelt man. Das ist klar. Ich krabble gerne mit dir, auf deinem Netz aus fremden Zitaten. Wir krabbeln von Zitat zu Zitat zwischen den Leerräumen hindurch. Sieh mal, sagst du manchmal, wenn wir einen Knoten erreichen, das ist doch besonders wahr.
Schließlich führst du mich zu deinem neuesten Netzknoten, der heißt: aus der unmittelbaren Unwirklichkeit. Das verstehe ich nicht. Ich will doch sein. Und wenn ich unwirklich bin, bin ich dann? Ich finde deinen Körper sehr schön, wie er über das Netz krabbelt. Du sagst, ich solle nicht ablenken von den Zitaten. Aber wieso denn nicht? Darf das nicht sein, dass ich deinen Körper schön finde? Soll ich mich in die Unwirklichkeit des Zitates flüchten, wo dein Körper nicht ist?
Dann habe ich eine tollkühne Idee: Sollen wir uns mal zwischen den Leerräumen des Netzes hindurchfallen lassen? Es sieht doch ganz gemütlich aus da unten. Dein Blick wird böse und du sagst: „Niemals! Niemals will ich mich da hinunterfallen lassen!“
Du machst mir Angst, und ich denke: Stimmt! Niemals sollen wir uns da hinunterfallen lassen! Ich ändere also meinen Plan und knüpfe stattdessen einen neuen Knoten im Netz, mit einem Zitat von mir: Wo wollen wir unsere Wahrheit finden? Wissen wir, wo wir unsere Wahrheit suchen sollen? Ich glaube, wir wollen nicht wissen, wo wir sie suchen sollen. Skeptisch siehst du diesen neuen Zitat-Knoten an und berührst ihn nicht; so als würde er bei der kleinsten Berührung nachgeben und dich in die Tiefe reißen. Ich selbst erschrecke mich auch vor diesem Zitat, denn ich ahne, dass Wahrheit etwas zu tun hat mit Sich-Fallen-Lassen.
Wir hängen im Netz und halten uns beide fest an Zitaten, die uns Halt geben sollen. Doch dann wird mir schwindelig. Ich kann mich nicht mehr halten und falle.
Ich falle weich und hart zugleich. Denn ich spüre Gewissheit unter mir und nicht mehr das Zappelige des Netzes. Es ist angenehm auf dem Grund. Ich sehe von unten, wie du auf dem Netz von Knoten zu Knoten krabbelst. Dann baust du einen neuen Knoten, und der sagt: Das Abendland hat die Schrift erfunden, um sich vor Bedrohungen zu schützen. Das Abendland hat doch nicht die Schrift erfunden!, denke ich mir, aber vielleicht verstehe ich davon zu wenig. Ich verstehe ja auch nicht, für was Pegida genau demonstriert. Worte sind viel zu mächtig, denke ich weiter, und bin froh, dass ich auf den Boden meiner Wahrheit gefallen bin. Worte werden noch viel mächtiger, wenn sie aufgeschrieben sind. Dann werden sie für allgemeine Wahrheiten gehalten und versperren den Blick auf die eigene Wahrheit. Ich will nichts denken; ich will sein, bewusstsein.
Dann nicke ich ein, und in meinem Traum sagt einer zur Menge:
„Keiner lügt hier! Ich suche die Wahrheit für alle. Ich will nur noch die Wahrheit hören, nichts als die Wahrheit!“
„Das wird schwer“, ruft ein anderer aus der Menge. „Woher soll ich denn wissen, was die Wahrheit ist? Ich lüge doch, wenn ich behaupte, dass ich weiß, was die Wahrheit ist.“
„Verräter!“, ruft der eine, und die Menge stürzt sich auf den anderen.
Erschreckt fahre ich hoch. Ich blicke nach oben und sehe dich über mir krabbeln und an deinem Netz basteln.
„Lass dich fallen!“ rufe ich dir zu.
„Das hättest du wohl gern.“
„Ja, das hätte ich gern. Sehr gern.“
„Das kannst du dir abschminken. Es ist viel zu gefährlich bei dir da unten. Viel zu gefährlich.“
Ich kann es kaum erwarten, dass du dich zu mir herunterfallen lässt. Doch vielleicht passiert es nie. Vielleicht ist es eine Wahrheit, die ich akzeptieren muss. Ich sehe, dass du Alkohol und Tabletten benutzt, um das Netz geschmeidig zu halten; denn die Worte allein werden zu schnell spröde und leer. Du baust eifrig an deinem Netz, machst die Knoten dichter; um den Fall ins Offene deiner Wahrheit zu verhindern, wo nichts mehr verborgen werden könnte.
Väter erzählen
In den Buchhandlungen gibt es Bücher zu kaufen, auf denen steht: „Papa, erzähl mal!“ Diese Bücher sind unbeschrieben und bestehen aus vielen weißen Seiten. Auf diese weißen Seiten sollen die Väter dann etwas hineinschreiben, also erzählen. Das klingt recht nett und niedlich. Trotzdem habe ich mich lange nicht getraut, so ein Buch zu kaufen und meinen Vater erzählen zu lassen. Das war mir nicht geheuer. Ich glaube, es ging ihm ähnlich, und so waren wir uns auf fatale Weise einig.
Um uns beide auszutricksen, habe ich bei meinem Urgroßvater angefangen und ihn gebeten, zu erzählen:
Urgroßvater (1883-1953)
Es war großartig. Ich hatte den Hof erworben mit der dazugehörigen Werkstatt. Alles lief prächtig. Die Kinder wurden geboren und wuchsen heran. Dann kam der Krieg. Anfangs dachte ich, das sei eine gute Sache, zu kämpfen für dieses unser schönes Land, zu kämpfen für den Kaiser. So etwas wie Niederlage kannte ich nicht. Es war doch nur bergauf gegangen bisher für mich.
Doch dann erlebte ich schreckliche Dinge. Ich sah Bomben die einschlugen und detonierten. Ich sah zerfetzte tote Körper, denen die Eingeweide heraushingen. Ich hatte Todesängste. Ich überlebte. Doch als es vorbei war und ich wieder nachhause kam an den Hof, war ich ein anderer. Ich bekam die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, die Bilder des Leidens und Sterbens. Immer wieder diese Bilder. Am schlimmsten war es, wenn mein ältester Sohn, dein Großvater, mich in einem solchem Moment ertappte, wenn die Bilder wieder auftauchten; denn in solchen Momenten stand ich da wie schockgefroren, vollkommen hilflos, und ich schämte mich dafür.
„Was ist denn?“ fragte er dann immer wieder, und er fragte es immer genervter, je älter er wurde. Ich sagte es sei nichts. Und wie ich ihn so heranwachsen sah, hatte ich immer mehr Angst, dass er auch so etwas erleben muss.
Großvater (1910-1955)
Ich habe meinem Vater und seiner Generation nie verziehen, was er mir und meiner Generation angetan hat. Erst verlieren sie den Krieg, weil sie zu feige waren zum Kämpfen. Dann kommt er nachhause und lässt den Hof halb verlottern mit seiner Nichtstuerei. Oft ertappte ich ihn dabei, dass er einfach nur dastand und dumm in die Gegend schaute. Er machte mich rasend vor Wut. Die Zeiten wurden immer schwieriger, und er tat nichts. Er schaute einfach nur zu. Ich wollte weg, wollte dazugehören zu denen, die etwas taten. Und die Neuen, die Nationalsozialisten, die taten endlich etwas, stürzten das untätige etablierte Pack von seinem Sockel. Mein Vater würde schon sehen!
Wie hätte ich denn wissen sollen, dass ich so enttäuscht werden würde? Alles verloren, obwohl ich so viel investiert hatte. Ich war erschöpft, am Boden, und nicht sicher, ob ich froh sein sollte, überlebt zu haben.
Mein Vater übergab mir den Hof, und ich musste ihm auch noch dankbar sein. Ich war nicht gern zuhause. Manchmal wünschte ich mir, meine Söhne wären nie geboren. Zuhause sein war für mich Kapitulation; das Aufgeben von all dem, was ich mir vom Leben erhofft hatte.
Vater (1941-1997)
Mein Vater, dein Großvater, war ein großartiger Mann; ein Draufgänger und Genie. Ich verstehe bis heute nicht, warum sein Bruder und nicht er die Werkstatt bekommen hat. Er war kein Bauer, nein, er war ein Visionär mit großem technischem Verständnis.
Mein Vater und sein Vater mochten sich nicht. Ständig ging mein Vater seinem Vater aus dem Weg. Oft war mein Vater in der Wirtschaft und meine Mutter hatte dann immer große Angst davor, dass er sehr betrunken und übellaunig nachhause kommen würde. Ich verstand ihn. Sollte er gut gelaunt sein? Niemand mochte ihn, obwohl er so ein großartiger Mann, so ein Draufgänger und Genie war.
Ich wollte auch so sein wie mein Vater, aber ich kam nie dazu, denn ich musste immer zuhause sein und meine kleinen Brüder hüten. Wieso verstand meine Mutter nicht, was für ein großartiger Mensch mein Vater war?
Mein Vater ist früh gestorben, keine zwei Jahre nach seinem Vater. Obwohl er seinen Vater nicht mochte, fehlte er ihm trotzdem sehr, nachdem er gestorben war. Ich glaube, er war sehr verbittert, weil ihn niemand mochte.
Immer wollte ich so sein wie mein Vater, aber ich kam nie dazu, auch nicht später im Leben. Immer stellte sich mir jemand oder etwas in den Weg. Ich habe es einfach nicht geschafft.
Ich habe Angst, mein Sohn, dass sich auch dir jemand oder etwas in den Weg stellt und du dem genauso schutzlos ausgeliefert bist wie ich. Aber ich merke, dass ich dir nicht helfen kann, dass du mir entgleitest, so wie mir alles entgleitet ist im Leben, was mir jemals wichtig war.
War es gut, meine Väter erzählen zu lassen? Ich haderte. Doch jetzt bin ich froh, dass sie ihr Schweigen gebrochen haben. Ich habe ihnen endlich verziehen für alles was sie getan und nicht getan haben. Ich habe die Kraft entdeckt, die sie mir geben. Ich habe gelernt, sie zu lieben und zu achten. Ich habe gelernt, mich zu lieben und zu achten und meinen Weg zu gehen; und dass sie auf diesem Weg meine größten Fans sind.
Wo ist das Problem?
Sie tanzen zur Musik. Ich stehe am Rand und gehe nicht hinein, zu ihnen und zur Musik. Ich sträube mich. Ich suche nach einem Grund, nicht zu ihnen hineinzugehen, aber es gibt keinen. Wo ist das Problem, denke ich mir, aber es gibt keines. Was mache ich nur?
Aus Rilkes Liebes-Lied:
… alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?
O süßes Lied.
Ich will wissen, wer der Geiger ist. Er scheint das Problem zu sein, weil er einen so gewaltsam da hineinzieht. Ich bin wütend auf ihn.
Doch nach dem Geiger zu fragen, heißt das nicht zu sagen: Wo ist das Problem? Nach dem Geiger zu fragen anstatt mit ihm mitzuschwingen, heißt das nicht: Ich sträube mich, werde unrund, arrhythmisch und disharmonisch? Ich schaffe ein Problem, weil ich es unbedingt benennen will.
Jetzt endlich: Ich gehe hinein, schwinge mit und tanze mit ihnen. Da ist eine Harmonie und Resonanz, die ich vorher nicht geahnt habe, weil ich so mit der Suche des Problems beschäftigt war.
Mauerbau
Wie soll ich es sagen? Ich fühle es nur. Sobald ich es denke, wird es überlagert von einer weißen, milchigen Schicht.
Ich versuche es: Ich habe Angst. Es fällt mir schwer es einzugestehen. Ich will keine Angst. Wieso diese Angst? Ich habe doch nichts getan.
Also haben andere etwas getan, dass ich Angst habe. Die anderen, natürlich. Die anderen. Die anderen! Sie werden nicht locker lassen. Ich muss mich schützen. Ich baue eine Mauer.
Ich starre auf die Mauer und habe noch immer Angst. Was tun wenn sie sie einreißen und über mich herfallen? Ich muss sie noch stärker bauen. Viel zu viele Gedanken. Die Angst brodelt gefährlich unter ihnen. Die Gedanken können sie nicht in Schach halten. Sie kämpfen verzweifelt gegen die brodelnde Hitze an.
Erschöpft gehe ich zu Boden. Sie sind sicher zu allem bereit auf der anderen Seite. Ich muss auf der Hut sein. Die dicke hohe Mauer ist vor mir. Ich fühle mich eingesperrt, tot. Was passiert, wenn sie die Mauer tatsächlich einreißen? Ich werde den Gedanken nicht los, dass sie die Mauer einreißen werden. Wie eine weiße, milchige Schicht legt er sich über meine Angst. Ich habe doch nie beabsichtigt, eine Mauer zu bauen. Ich habe doch nur getan, was man tun musste. Kann man toter als tot sein?
Ich habe Angst. Und bin so allein mit ihr. Ich habe Angst zu leben.