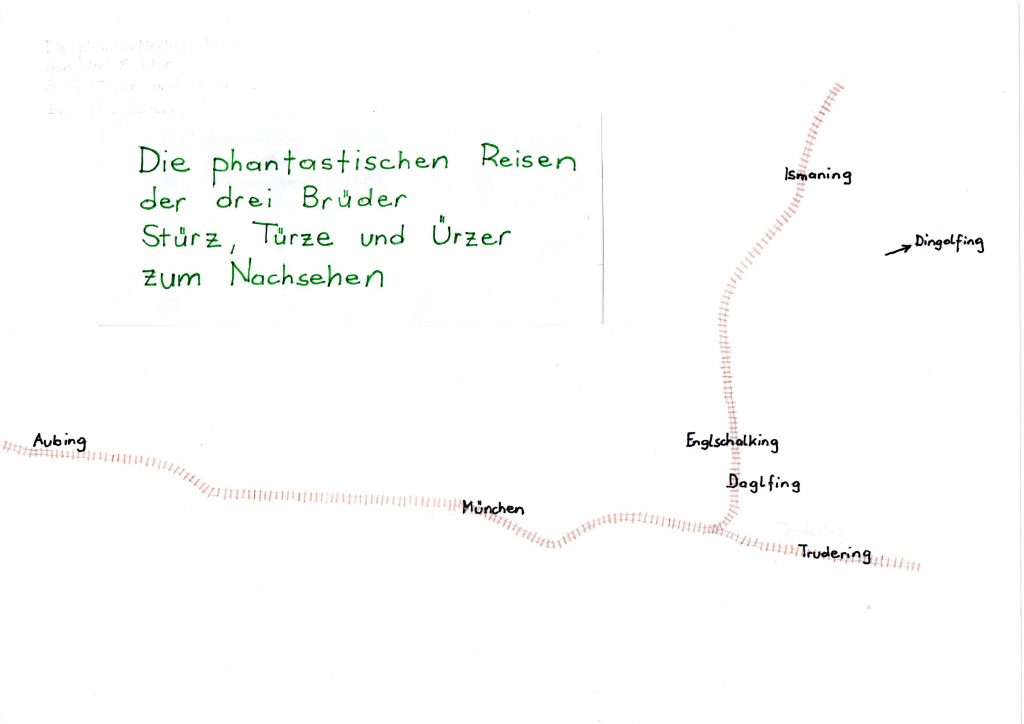ein Stück für zwei Personen
Vater (Mitte vierzig)
Sohn (elf Jahre alt)
Der Vater hält den Sohn in fester Umklammerung. Der Sohn schaut ihm über die Schulter, den Blick sehnsuchtsvoll in die Ferne gewandt, und will sich aus der Umklammerung befreien. Der Vater aber hält ihn stoisch fest, scheinbar liebevoll, aber doch auf eine subtile Art gewaltsam.
Vater: Mein Junge, mein Junge, mein lieber kleiner Junge!
Der Sohn entkommt der Umklammerung und wendet sich mit stolzer Brust vom Vater ab. Der Vater schaut den Sohn traurig von hinten an.
Vater: Ich habe alle Tischkanten abgeschrägt, damit du dir nicht mehr den Kopf an ihnen aufschlägst.
Sohn: Ich schlage mir den Kopf nicht mehr auf.
Der Sohn geht ein paar Schritte.
Vater: Wo gehst du hin?
Sohn: In den Garten.
Vater: In welchen Garten?
Sohn: In den Obstgarten.
Vater: Nein! Bitte nicht! Der Obstgarten liegt direkt neben der Straße. Wenn wieder ein Auto von der Straße abkommt, wird es dich zu Tode fahren.
Sohn: Die Autos kommen nicht von der Straße ab. Sie bleiben auf der Straße. Außerdem haben sie jetzt eine Leitplanke montiert, die ein Auto nicht mehr von der Straße abkommen lässt.
Vater: Ach, Leitplanke! Neulich wurde ein Auto von der Leitplanke ausgehoben und kopfüber in den Garten geworfen. Normalerweise wäre der Fahrer gestorben. Wie durch ein Wunder hat er überlebt. – Du warst nicht da, als dieser Unfall passierte.
Sohn: (genervt) Nein, ich war auf Landschulwoche. – Ich gehe jetzt in den Garten!
Vater: In den Obstgarten?
Sohn: Ja, in den Obstgarten!
Vater: Wieso musst du jetzt in den Obstgarten gehen? Es ist zu gefährlich!
Sohn: Ich will jetzt in den Obstgarten gehen! Ich will sehen, ob es schon rote Äpfel gibt.
Vater: Die Äpfel! Die Äpfel! Ich bin der Meinung, man sollte den Apfelbaum fällen. Es ist viel zu gefährlich, sich dort aufzuhalten, direkt neben der Straße, wo jederzeit ein Unfall passieren…
Sohn: (unterbricht den Vater) Es ist wunderschön im Schatten des Apfelbaums.
Vater: Immer diese Sturheit! Wenn ich etwas sage, sagst du genau das Gegenteil. Wieso hört mir eigentlich nie jemand zu?
Sohn: Ich will einfach nur in den Obstgarten gehen.
Vater: Es ist zu gefährlich! Lass dir das sagen! Ich weiß, was gefährlich ist. Ich weiß es noch genau, damals, als die Amerikaner Salzburg bombardierten…
Sohn: Was haben die Bomben auf Salzburg damit zu tun, dass ich in den Obstgarten gehen will? Immer entwickelst du aus Lappalien deine Horrorgeschichten! Hör endlich auf damit! Niemanden interessiert das!
Vater: Aber es war ein flammendes Inferno damals. Die Nacht war hellerleuchtet…
Sohn: (stürmt auf den Vater zu und schlägt auf ihn ein) Hör endlich auf mit dieser damit! Es interessiert mich nicht!
Der Vater holt mit der Hand aus, gefriert dann aber in seiner Bewegung und fängt zu weinen an.
Der Sohn geht in den Obstgarten, steigt auf die Leitplanke und lässt die Autos nah an sich vorbeirauschen.
Sohn: Frei! Ich bin frei!